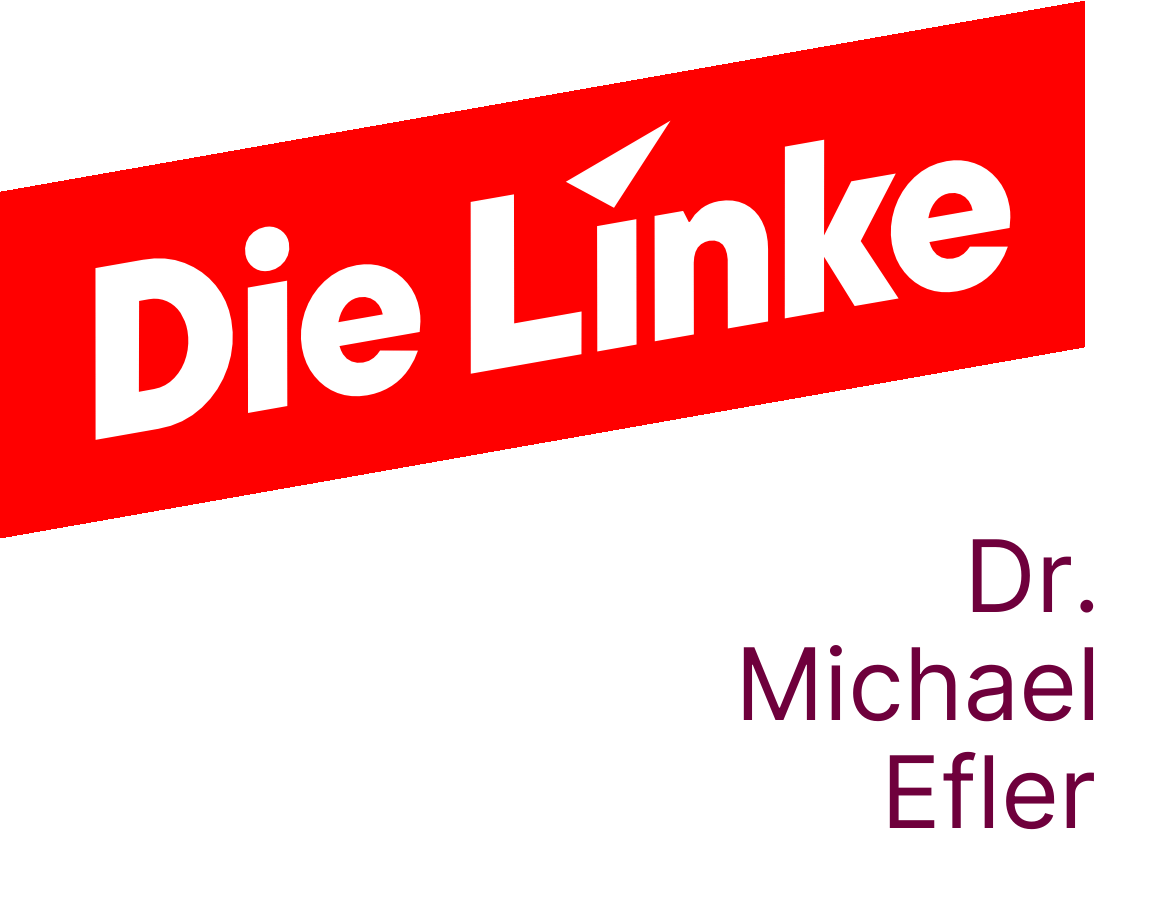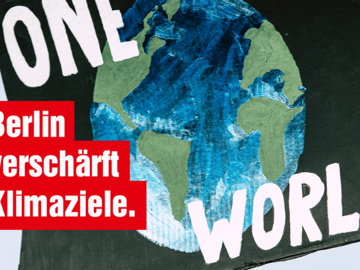Gemeinsame Pressemitteilung der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Weiterlesen
Zur heutigen Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses zum Erwerb des Berliner Stromnetzes Weiterlesen
Gemeinsame Pressemitteilung der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Weiterlesen